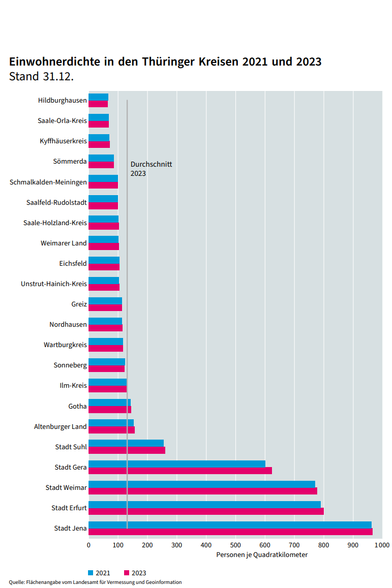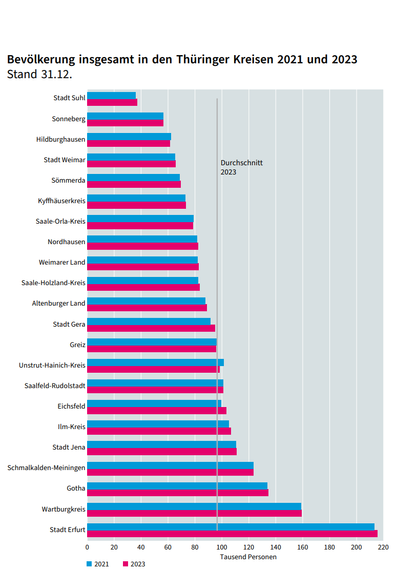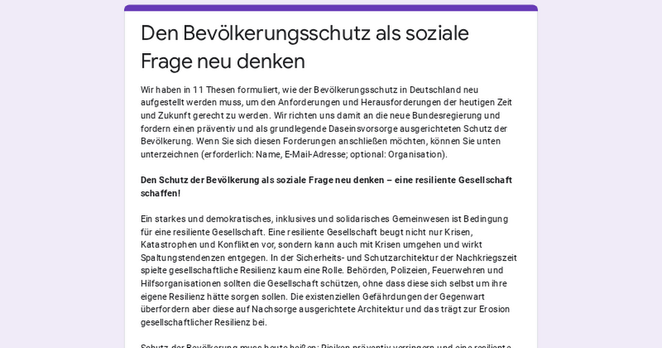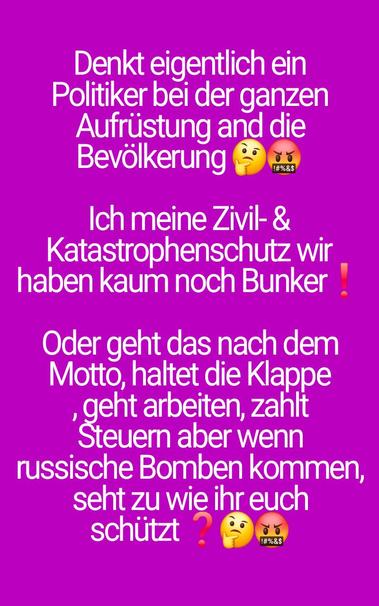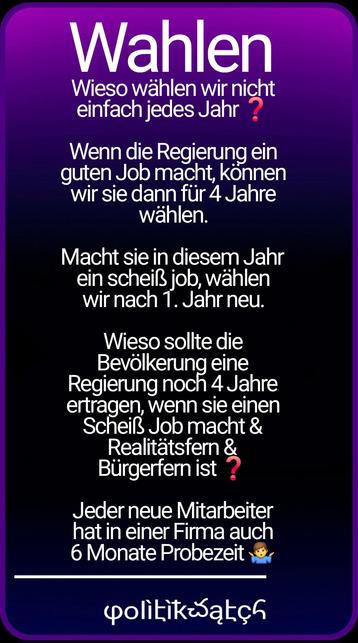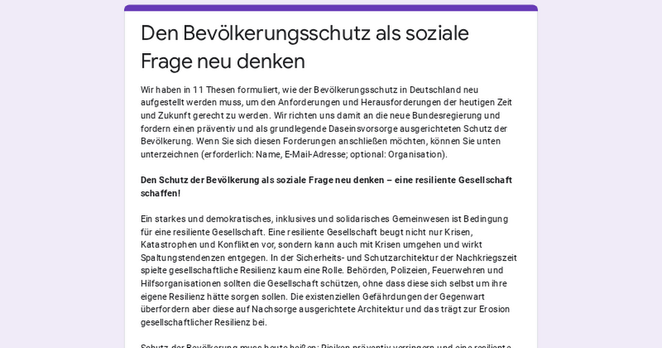
Google DocsDen Bevölkerungsschutz als soziale Frage neu denkenWir haben in 11 Thesen formuliert, wie der Bevölkerungsschutz in Deutschland neu aufgestellt werden muss, um den Anforderungen und Herausforderungen der heutigen Zeit und Zukunft gerecht zu werden. Wir richten uns damit an die neue Bundesregierung und fordern einen präventiv und als grundlegende Daseinsvorsorge ausgerichteten Schutz der Bevölkerung. Wenn Sie sich diesen Forderungen anschließen möchten, können Sie unten unterzeichnen (erforderlich: Name, E-Mail-Adresse; optional: Organisation).
Den Schutz der Bevölkerung als soziale Frage neu denken – eine resiliente Gesellschaft schaffen!
Ein starkes und demokratisches, inklusives und solidarisches Gemeinwesen ist Bedingung für eine resiliente Gesellschaft. Eine resiliente Gesellschaft beugt nicht nur Krisen, Katastrophen und Konflikten vor, sondern kann auch mit Krisen umgehen und wirkt Spaltungstendenzen entgegen. In der Sicherheits- und Schutzarchitektur der Nachkriegszeit spielte gesellschaftliche Resilienz kaum eine Rolle. Behörden, Polizeien, Feuerwehren und Hilfsorganisationen sollten die Gesellschaft schützen, ohne dass diese sich selbst um ihre eigene Resilienz hätte sorgen sollen. Die existenziellen Gefährdungen der Gegenwart überfordern aber diese auf Nachsorge ausgerichtete Architektur und das trägt zur Erosion gesellschaftlicher Resilienz bei.
Schutz der Bevölkerung muss heute heißen: Risiken präventiv verringern und eine resiliente Gesellschaft schaffen. Bevölkerungsschutz ist grundlegende Daseinsvorsorge. Dazu muss die “soziale Frage” wieder in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit Sicherheits- und Schutzfragen rücken, also die Sicherung der sozialen Grundlagen des Gemeinwesens. Dies gilt für alle Ebenen im föderalen Staat: Kommunen, Länder, Bund und Europa.
Jeder Mensch verdient Respekt, Schutz und Sicherheit. Nur wenn Risiken, Lasten und Chancen fair verteilt sind, nur wenn niemand um die Daseinsgrundlagen fürchten muss, nur wenn der würdevolle Umgang miteinander Dreh- und Angelpunkt allen gesellschaftlichen Handelns bleibt und alle zuversichtlich auf den weiteren eigenen Lebensverlauf und eine lebenswerte Zukunft blicken können, kann daraus eine resiliente Gesellschaft erwachsen.
Eine umfassende Transformation ist notwendig, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Die wachsenden Risiken durch Klimawandel, soziale Ungleichheit, politische Polarisierung und technologische Abhängigkeiten erfordern nicht nur ein Umdenken, sondern einen tiefgreifenden Wandel in unseren Strukturen, Prioritäten und Handlungsweisen. Es geht darum, die Prinzipien von Solidarität, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in den Kern unseres Handelns zu stellen. Diese Transformation muss alle gesellschaftlichen Ebenen durchdringen und gleichzeitig ein neues Verständnis von Verantwortung, Beteiligung und Kooperation fördern. Denn nur durch ein gemeinsames Wirken können wir die Voraussetzungen für eine widerstandsfähige Gesellschaft schaffen, die sowohl Krisen bewältigt als auch eine lebenswerte Zukunft für alle gestaltet.
These 1: Zusammenhalt
Eine Gesellschaft, die die soziale Frage aus dem Blick verliert, kann nicht resilient sein. Eine demokratische Gesellschaft, die nicht zusammenhält, ist gegenüber ihren äußeren als auch inneren Gegnern verletzlich. Zumal, wenn diese Gegner aus der Gesellschaft heraus die Grundlagen des freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens unterminieren. Der Kern des Zusammenhalts ist die Bewahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dazu gehören die Achtung der menschlichen Würde sowie das Rechtsstaatsprinzip, insbesondere das staatliche Gewaltmonopol in Verbindung mit der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt sowie die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte.
These 2: Gleichheit
Soziale Ungleichheit unterminiert den sozialen Zusammenhalt. In einer zunehmend ungleicher werdenden Gesellschaft werden Menschen mit weniger sozioökonomischen und kulturellen Ressourcen verletzlicher, während sich andere den Auswirkungen von Krisen und Konflikten entziehen können. Es brechen zunehmend Konflikte auf, die sich an ganz unterschiedlichen Triggerpunkten entzünden.
Diese Konfliktarenen werden zum Einfallstor für die Gegner einer offenen und demokratischen Gesellschaft. So sind etwa die Bekämpfung von Armut, die Förderung inklusiver sozialer Strukturen, die Geschlechtergerechtigkeit oder auch die Verteilung von Care-Arbeit und die Stärkung einer demokratischen Debattenkultur Eckpfeiler einer resilienten Gesellschaft.
These 3: Menschenschutz
Der Staat verpflichtet sich zum Schutz der Bevölkerung, die staatlichen Schutzpflichten gehen von der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz aus und stellen die Würde des Menschen, die Unverletzlichkeit von Menschenrechten und das Sozialstaatsprinzip in den Mittelpunkt. Klimawandel, Artenverlust und technische Entwicklungen bedrohen das Leben auf unserem Planeten existenziell. Der Staat ist verfassungsrechtlich verpflichtet, im Rahmen einer kontinuierlichen Freiheitssicherung auch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu bewahren. Der Staat hat diese Grundprinzipien konsequent zu beachten, um das Vertrauen in staatliche Institutionen und damit den sozialen Zusammenhalt - generationenübergreifend - zu bewahren. Zur staatlichen Daseinsfürsorge gehört auch ein starker Bevölkerungsschutz als gemeinschaftliche Aufgabe aller Ebenen.
These 4: Vorsorge
Gesellschaftliche, klimatische, ökologische und technische Entwicklungen bringen existenzielle Risiken und Gefahren hervor. Ein nachsorgender Ansatz versagt gegenüber diesen Entwicklungen. Das Vorsorgeprinzip muss zum gesamtgesellschaftlichen Handlungsrahmen und zur Querschnittsaufgabe jeglichen staatlichen Handelns werden: Risiken und Gefahren müssen umfassend und systemisch evaluiert und vermieden werden, wenn mit ihnen ein gesellschaftlich nicht vertretbares Schadenspotential einhergeht. Um dies demokratisch und fair zu bewerten, bedarf es mehr Transparenz sowie unabhängiger und zivilgesellschaftlicher Kontrollinstanzen.
These 5: Wehrhaftigkeit
Der beste Schutz vor Angriffen jeglicher Art ist eine auf die konsequente Einhaltung des Völkerrechts sowie auf Verständigung angelegte Innen- und Außenpolitik. Das sehen wir an der Entwicklung von Deutschland und insbesondere der Europäischen Union. Dennoch zeigen z. B. der Angriffskrieg Russlands unter Wladimir Putin gegen die Ukraine oder hybride Angriffe - auch gegen Deutschland -, dass die Verteidigungsfähigkeit eines Staates vor der Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen wesentlich ist. Der wirksame Schutz der Bevölkerung muss dabei auch die Wehrhaftigkeit in der inneren Sicherheit gewährleisten. Drohende Folgen eines Angriffs hängen entscheidend davon ab, inwieweit ein Staat und seine Gesellschaft geschützt, wehrhaft und resilient sind.
These 6: Langfriststrategie
Die Bewältigung der Geflüchtetenlage 2015/2016, das Management der Corona-Pandemie oder das Hochwasser im Juli 2021 haben gravierende Schwachstellen und Mängel in den Ausstattungen und Fähigkeiten des Krisen- und Katastrophenmanagements auf allen Ebenen aufgezeigt. Der Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen - zu denen hybride Formen ebenso gehören wie mit konventionellen Waffen geführte Kriege - wird neben technischen Schutzvorkehrungen oder einer verteidigungsfähigen Armee durch innere Faktoren beeinflusst, die eine Gesellschaft resilienter machen. Zu einer resilienten Gesellschaft gehört insbesondere ein resilienter und leistungsfähiger Bevölkerungsschutz.
Die Resilienz der Gesellschaft ist als Leitmotiv bei grundlegenden strukturpolitischen, ebenso wie bei ökonomischen oder technikorientierten Entscheidungen mitzudenken. Dabei ist der analytische Prozess in permanente reflektierende Strukturen zu überführen. “Katastrophenverdrängung” und „Präventionsignoranz“ sind durch ein dauerhaftes und in die Zukunft gerichtetes resilientes gesamtgesellschaftliches Risikobewusstsein zu überwinden. Forschung und Evaluation müssen unabhängig und ergebnisoffen sein. Die Empfehlungen aus Studien und durchgeführten Übungen, die realistische Szenarien abdecken, müssen umgesetzt werden.
These 7: Kritische Infrastrukturen (KRITIS)
Der Staat kann die Daseinsvorsorge nur dann gewährleisten, wenn die kritischen Dienstleistungen für die Bevölkerung verfügbar sind. Brechen diese weg, ist nicht nur die öffentliche Sicherheit oder die Versorgung gefährdet, sondern darüber hinaus auch der Bevölkerungsschutz. Schon eine Beeinträchtigung von kritischen Dienstleistungen kann zur Destabilisierung der Bevölkerung führen. Daher erfordert die Aufrechthaltung und Resilienz der KRITIS staatliches Handeln.
Alle kritischen Infrastrukturen in Deutschland sind sowohl im Cyberraum als auch in der physischen Sicherheit vorausschauend und resilient zu gestalten. Hierzu gehören insbesondere die Sektoren “Medien und Kultur” sowie “Staat und Verwaltung”.
These 8: Nachhaltigkeit
Ein kurzfristig gedachtes Effizienzkalkül ausgelegt auf reine Gewinnmaximierung führt nicht zu gesamtgesellschaftlicher Resilienz, sondern untergräbt diese sogar. Über Jahrzehnte wurde der Resilienz keine Bedeutung mehr beigemessen. Das erforderliche Umdenken betrifft sämtliche Lebensbereiche. So wurden bspw. über Jahrzehnte kritische Infrastrukturen verbaut, ohne dabei die Möglichkeit hybrider Angriffe und Folgen des Klimawandels als entscheidende Risiken zu bedenken. Eine umfassende Überprüfung bestehender Verletzlichkeiten und Abhängigkeiten ist erforderlich.
These 9: Bestandsaufnahme Föderalismus
Die föderale Architektur weist im Kontext der Bewältigung größerer, Ländergrenzen überschreitender Katastrophen und komplexen Krisen deutliche Schwächen auf. Zivil- und Katastrophenschutz sind trotz getrennter Zuständigkeiten von Bund und Ländern aufs Engste miteinander verzahnt, z.B. über den „Doppelnutzen“, über Mehrfachengagement der Helfenden usw. Eine transparente Bestandsaufnahme über die für den Katastrophenfall bundesweit bestehenden Ressourcen scheiterte über Jahrzehnte insbesondere am Widerstand der Länder oder unter dem Vorwand des vorgeschobenen Datenschutzes. Eine solche Bestandsaufnahme ist eine entscheidende Planungsgrundlage für einen vorausschauenden Schutz der Bevölkerung. Die institutionell bedingte Verschränktheit von Ebenen führt dazu, dass nur um Einzelinteressen gekämpft wird und das gesamte Bevölkerungsschutz-System ohne strategische Vorausschau agiert. Die resultierende Verantwortungsdiffusion ist zu adressieren und das Koordinierungsproblem zu eliminieren. Dafür ist der Bevölkerungsschutz als Gemeinschaftsaufgabe aller Ebenen zu betrachten.
These 10: Ressortdenken
In der Krise müssen alle aktiv Verantwortung übernehmen. Institutionelle Barrieren und Bürokratie sind in einer offenen, rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung nicht gänzlich vermeidbar. Sie werden aber immer schnelle Entscheidungen erschweren und sind im Friedensfall, im Falle eines hybriden Angriffes und auch bei einem Katastrophenfall ein Problem. Die strukturellen, institutionellen und Bürokratiebarrieren sind zu überprüfen. Die ermittelten Ergebnisse dürfen nicht vor weitreichenden Konsequenzen, bspw. hinsichtlich der föderalen Architektur, zurückschrecken. Verwaltungsrechtliche Aufsichts- und Weisungsrechte sind konsequent wahrzunehmen.
These 11: Generationengerechtigkeit
Die generationsübergreifenden Herausforderungen durch Klimawandel, Sicherung des Friedens und Schutz der Bevölkerung vor weiteren Gefahren sind über die Tagespolitik hinaus langfristig zu adressieren. Als grundlegende Daseinsvorsorge müssen sie Bestandteil einer sicherheitspolitischen Zeitenwende sein. Dazu sind sie im Sinne eines gesamtstaatlichen und integrierten Sicherheitsbegriffs zu betrachten. Die Finanzierung notwendiger Einzelmaßnahmen führt immer wieder zu Verteilungskonflikten, die das Vertrauen in die demokratischen Institutionen erodieren lassen. Eine undifferenzierte Austeritätspolitik - also die derzeitige Auslegung der Schuldenbremse - wirkt hier dysfunktional und zerstörerisch für die Grundlagen der Existenz. Die Kosten für Prävention, Anpassung und Schutz sind deshalb zum größten Teil in einem dauerhaften Generationenvertrag abzusichern. Notwendige Maßnahmen sind unter Beteiligung aller, also insbesondere auch der Zivilgesellschaft, Praxis und Wissenschaft zu definieren. Hierbei ist der Blick auf generationsübergreifende Notwendigkeiten entkoppelt von der Finanzierungs- und Lastenverteilungsfrage zu richten.
Autor*innen (in alphabetischer Reihenfolge)
Manuel 'honkhase' Atug, AG KRITIS
Dr.-Ing. Sylvia Bach, Bergische Universität Wuppertal
Jens von den Berken, Ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz
Leon Eckert, MdB
Andreas Kling, con-bility
Dr. Marco Krüger, Universität Tübingen
Prof. Dr. Jakob Schirmer, HSPV NRW
Prof. Dr. Martin Voss, KFS, FU Berlin
Unterzeichner*innen (in alphabetischer Reihenfolge, 220 Unterschriften, Stand 19.03.2025)
Uwe Adler, Mitglied des Landtages Brandenburg
Jens Adolf
Prof.'in Dr. Regina Ammicht Quinn, Universität Tübingen
Magdalena Annerbo, Berufsfeuerwehr Bonn
Torsten Arndt, Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Lars Klaus Aßhauer
Dr. Jens Baganz
Sebastian T. Baum, Berater, Dozent, Autor und ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz
Axel Bauer, Junge Liste Backnang
Manfred Bauer, Auditor mit Schwerpunkt KRITIS (datenschutz cert GmbH)
Joachim Baumeister
Dr. Volker Baier
Franziskus Bayer
Dr. Albrecht A. Beck, Prepared International (PPI)
Reinhold Becker
Uwe Becker
Wilko Beinlich
Elena Bengeßer
Frank Birkenhauer
Nicolas Bock, KFS, FU Berlin
Verena Bosch, THW Jugend e. V.
Prof. Dr. Stefan Böschen, RWTH Aachen University
Christoph Brodesser, DRK-OV Nordwalde
Prof. Dr. Eva Brucherseifer, Hochschule Darmstadt
Prof. Dr. Marius Busemeyer, Universität Konstanz
Henrik Cordsen
Stefan Demant, Dussmann Group
Prof. Dr. Thomas Diez, Universität Tübingen
Dr. Cordula Dittmer, Akademie der Katastrophenforschungsstelle (AKFS)
Lea Dohm, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG)
Anke Domscheit-Berg, MdB
Daniel Domscheit-Berg, havel:lab e.V.
Raphael Donnevert
Johannes Dülks, BSI
Jörg Eger, THW
Patrick Eiser
Dr. Nils Ellebrecht, Uniklinikum Freiburg
Prof.'in Dr. Astrid Elsbernd, Hochschule Esslingen
Prof. Dr. Michael Ewers, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Christian Eymery
Dr.-Ing. Ramian Fathi
Regina Fleischmann, Universität Freiburg
Prof. Dr.-Ing. Frank Fiedrich, Bergische Universität Wuppertal
Markus Försch
Vasili Franco, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
Nils Freitag, FOM Hochschule für Ökonomie und Management
Niklas Frings, Bergische Universität Wuppertal
Jörg Fraune
Markus Frost, Führungskraft im Bevölkerungsschutz
Friedrich Gabel, Universität Tübingen
Alexandra Geckeler, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.
Sina Giesemann, DRK Generalsekretariat Berlin
Cjristian Gießler
Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken, Universität der Bundeswehr München
Dr. Wolfram Geier, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.
Dr. Paul Geoerg
Prof. Dr. Lars Gerhold, TU Braunschweig
Ferdinand Gehringer, Konrad-Adenauer-Stiftung
Friedel Gepp
Heiko Gernetzki, Landkreis Vorpommern-Rügen
Paula Gnielinski, Universtiät Potsdam
Prof. Dr. Henning Goersch, FOM Hochschule für Ökonomie und Management
Nico Gramenz, Kriegsbewusst
Sabine Grützmacher, MdB
Paula Sophie Günther
Prof. Dr. Christoph Gusy, Universität Bielefeld
Sophie-Bo Haffner, Universität zu Köln
Dr. Kathrin Happe
Ingo Happel-Emrich
Manuel Haß
Hanna Haug
Prof.'in Dr. Rita Haverkamp, Universität Tübingen
Prof.'in Dr. Jessica Heesen, Universität Tübingen
Hanno Heeskens
Jan Heinemann, Fight Club Deutschland / International
Hagen Heinze, Landkreis Vorpommern-Rügen
Tobias Heisterkamp
Martin Hellmann
Inga Hennig-Finke, DRK LV Westfalen-Lippe
Sebastian Herbe, Akkon Hochschule für Humanwissenschaften
Dr. Sven Herpig
Carina Hinrichs
Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck, Center for Security and Society, Universität Freiburg
Christian Hofeditz, Kreisvolkshochschule Ahrweiler e.V.
Prof.'in Dr. Gesine Hofinger, Akkon Hochschule für Humanwissenschaften
Maik Holtz, Feuerwehrbeamter im KatS-Management
Dr. Bernhard Horst, Ingenieurbüro Bernhard Horst
Julia Höller, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen
Dr. Frank Höndgen
Prof. Dr. Henning Höppe, Universität Augsburg
Thomas Jackwerth, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin
Alexander Jäger
Rainer Jochem
Prof. Dr. Harald Karutz, MSH Medical School Hamburg
Jannika Kassel
René Kastner
Torsten Kelle, Ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz
Frank-Peter Kern, Gesellschaft für Krisenvorsorge
Alexander Kille
Frieder Kircher, Gemeinsamer Ausschuss für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung von DFV und vfdb
Nikolaus Klumpp, Unternehmensberater
Uwe Knappe, ABF Apotheken
Ben Koch, Fachdienst Bevölkerungsschutz, Landkreis Vorpommern-Rügen
Eva Koch, Stiftung Naturschutz Berlin
Sebastian Koch, Universität Konstanz
Dr. Michael Köhler, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Matthias Kötter
Joachim Kowalke, Notfallseelsorge Mannheim
Thomas Kox, Weizenbaum Institut
Prof. Marcel Kuhlmey, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Jörg M. Krause
Dr. Stefan Kroll, Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung
Dr. Petra Krüger, THW
Vanessa Kruse
Sophie Lacher, RPTU Kaiserslautern-Landau
Wiebke Lass, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
Dr.-Ing. Daniel Lichte
Sascha Lienesch, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen
Christoph Liesche, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Valentin Lippmann, Mitglied des Landtages Sachsen
Jan Lobermeier
Prof. Dr. Karsten Loer, HAW Hamburg
Anna Loll, DLF/Arte
Dr. Daniel Lorenz, KFS, FU Berlin
Simon Lorenz
Max Luber
Dr. Tim Lukas, Bergische Universität Wuppertal
Sonja Lüpke
Soenke Marahrens, BW
Erich Marks, Deutscher Präventionstag
Prof. Dr. Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München
Sarah Mc Nelis
Prof.'in Marion Meinert, Hochschule Furtwangen
Oliver Meisenberg, ARKAT
Michael Meister, THW
Matthias Meixner
Michel Messerschmidt
Dr. Lioba Meyer
Dr. Michael Middelhoff, Universität Münster
Thomas Mitschke, Ehemaliger Leiter der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ)
Carsten Mohr, Moderator im Podcast ImBrandschutzMilieu
Susanna Mohr, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | CEDIM
Patrick Moldenhauer
Harald Müller, THW
Jan Müller-Tischer
Lina-Marie Müller
Thomas Mülling, THW
Luisa Neubauer, Fridays for Future
Lisa Odendahl
Jacqueline Désirée Oppers, Bergische Universität Wuppertal
Tamara L. Orschler, St. Sebastian Project
Manuel Packhäuser
Dr.-Ing. Matthias Parey
Sandra Pichler, Disaster Competence Network Austria
Dr. Thomas Poschkamp, Gesundheitsamt Landeshauptstadt Düsseldorf
Andreas Poth, ehrenamtlicher Notfallseelsorger
Prof. Dr. Thomas Potthast, Universität Tübingen
Peter Priesmeier
Simon Putzke
Anna Rau, Deutsch-Europäisches Forum für Urbane Sicherheit
Jonathan Raschke
Hannah Reinartz, Universität Bonn
Ulf Riechen, AG KRITIS
Björn Roggenbuck, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.
Karsten Rohrbach
Andreas Rudlof, Arbeitsgemeinschaft der Werkfeuerwehren Baden-Württemberg e.V.
Johannes 'ijon' Rundfeldt, AG KRITIS
Alexander Salomon, Mitglied des Landtages Baden-Württemberg
Dr. Vicente Sandoval, KFS, FU Berlin
Ulrike Sasse-Zeltner, HumTec RWTH Aachen
PD Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München
Herbert Saurugg, Gesellschaft für Krisenvorsorge
Lawrence Schätzle, Deutsches Institut für Urbanistik
Dr. Benjamin Scharte, Universität Tübingen
Ludger Schattel, Landesbehörde i. R.
Yannic Schulte, Bergische Universität Wuppertal
Alexandra Schmitt, Bergische Universität Wuppertal
Maik Schneider
Malte Schönefeld
Jürgen Schreiber, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.
Prof.'in Dr. Patricia M. Schütte, Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW
Andrea Schwarz, Mitglied des Landtages Baden-Württemberg
Dr. Naomi Shulman, Technische Universität Braunschweig
Michael Skala, DKKV Young Professionals
Christian Skibak, ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz
Manuel Soler, Geraffel Village
Christian von Spiczak, Feuerwehr Duisburg - Bevölkerungsschutz
Stephan Springer, AG KRITIS
Ralph Stark
Dr. Till Steffen, MdB
Prof. Dr.-Ing. Alexander Stolz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Dr. Benni Thiebes, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.
Dr. Nadja Thiessen, TU Darmstadt
Samuel Tomczyk, Universität Greifswald
Jan Trapp, Deutsches Institut für Urbanistik
Dr. Josephine Tröger, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung
Thomas Uihlein, International Crisis Academy
Anissa Vogel, Universität zu Köln
Andreas Wagenplast
Hanno Wagner
Johannes M. Waldmüller, Universität Genf
Thomas Wallutis
Janosch Weinmann
Dennis Wengenroth
Rainer Wenke
Lasse Wennerhold, TU Braunschweig
Dr. Adam Widera, Universität Münster
Patrick Wiedemann, THW Jugend e. V.
Thomas Wiegold, Journalist
Marius Wiersch
Gerhard Wiese, Volt DE
Ian Wilken, THW / JUH
Daniel Willeke, Bundesverband Klimaschutz e. V.
Peter Windsheimer, KFS, FU Berlin
Ronja Winkhardt-Enz, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.
Ruth Winter
Dominik Wittkamp
Floris Wittner
Martin Wölfel, AG KRITIS
Kristin Wündisch, Landeshauptstadt München
Michael Wüst, THW
Jonas Zechner
Andreas Zeisiger, AG KRITIS
Kerstin Zettl-Schabath
Prof. Dr. Andreas Zick, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld
Markus Zimmermann, Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachdienstleiter
Theresa Zimmermann, KFS, FU Berlin
Tobias Zweckerl